Das Hansaviertel liegt vom Großen Stern und der Siegessäule fußläufig gerade einmal wenige Schritte entfernt. Hier steht optisch betrachtet ein „wildes Durcheinander“ an Gebäuden, die nicht zusammen passen. Das diese Gebäude von bekannten Architekten stammen und warum sie dort entstanden sind, das ist eine besondere Geschichte.
Geschichte des Hansaviertels
Ende des 18.Jahrhunderts waren die „Schöneberger Wiesen“ noch unbebautes Überschwemmungsgebiet. Doch recht schnell entwickelte sich das Gebiet zu einem bürgerlichen Berliner Wohngebiet. 1874 begann die Berlin-Hamburger Immobilien-Gesellschaft das Gelände zu erschließen, damit war das Hansaviertel „geboren“.
Die Stadtbahn, die von 1877-1882 errichtet wurde, verband das Hansaviertel mit der Innenstadt. Gleichzeitig teilte sie das Gebiet in zwei Bereich. Auf langen schmalen Parzellen errichtete man Wohngebäude in Straßenrandbebauung. Diese Häuser waren repräsentativ, hatten kleine Vorgärten und waren in Vorder- und Hinterhaus mit kleinen Innenhöfen gegliedert.
In den neunziger Jahren des 19.Jahrhunderts war die Bebauung weitestgehend abgeschlossen. 1895 weihte man die Votivkirche Kaiser-Friedrich-Gedächniskirche ein. Eine katholische Kirche entstand 1926 in der Altonaer Strasse. Es gab auch zwei Synagogen im Hansaviertel. Der Anteil der jüdischen Bevölkerung war im Vergleich zu anderen Bereichen Berlins recht hoch.
Zerstörung des Hansaviertels
Während der nationalsozialistischen Diktatur veränderte sich das Hansaviertel zusehens. In der Reichspogromnacht am 9.11.1938 zerstörte man die Synagogen des Viertels.
Die Pläne Speers Berlin zu der Reichshauptstadt Germania zu verwandeln, wirkten sich auch auf das Hansaviertel aus. Um Platz für arische Mieter aus einem Abrissgebiet zu schaffen, ordnete Speer 1941 die „Entjudung“ des Viertels an. Als es dann im März und November zu den massiven Luftangriffen der Alliierten Luftwaffe kam, wurden etwa zwei Drittel des Hansaviertels zerstört. Von 343 Wohnbauten überstanden gerade einmal 70 weitgehend die Zerstörung durch die Bomben und das Feuer. Auch die Kirchen waren zerstört.
Zunächst versuchte man die verbleibenden Wohnungen, die ja ursprünglich sehr groß gebaut worden waren, in kleinere Wohneinheiten aufzugliedern, um so möglichst vielen Menschen eine Unterkunft zu verschaffen.
Die Wohnungsnot war so groß, dass der Bezirk Tiergarten 1951 einen Wettbewerb zum Wiederaufbau ausschreiben wollte, was der Berliner Senat aber nicht genehmigte. Er erließ einen Baustopp für das gesamte Hansaviertel und so lag wertvoller Grund und Boden brach. Erst 1953 schrieb der Senat selbst einen Ideenwettbewerb für den Wiederaufbau des Hansaviertels aus und erklärte das Gebiet zum Zentrum der Internationalen Bauausstellung Interbau. Diese sollte 1957 in Berlin stattfinden.
Der Wiederaufbau des Hansaviertels
Auf 25 ha entstanden in relativ kurzer Zeit 1300 Wohneinheiten, eine Bücherei, zwei Kirchen, eine Kindertagesstätte, eine Grundschule und ein Einkaufszentrum. Über 50 weltweitbekannte Architekten aus 14 Ländern waren an den Planungen der Gebäude beteiligt. Großzügige Grünflächen wurden von zehn Landschaftsplanern angelegt.
Es entstanden verschiedene Gebäudetypen: Punkthochhäuser und viergeschossige Wohnzeilen am S-Bahn-Bogen, Scheibenhochhäuser mit 8 bis 9 Geschossen, flache Atrium- und Winkelhäuser.
Zur Eröffnung der Interbau war erst gut ein Drittel der Bauten fertig gestellt, bis zum Anfang der 1960er Jahre folgten die restlichen Bauten.
Rundgang durch das Hansaviertel
Mein Rundgang beginnt am Einkaufszentrum des Hansaviertels. Hier befindet sich im ehemaligen Kino heute das bekannte Jugendtheater GRIPS. Die Auswahl an Geschäften ist eher begrenzt. Vor einigen Jahren war hier eindeutig mehr los, heute wirkt es sehr runtergekommen.
Bartningallee
Direkt hinter dem Einkaufszentrum in der Bartningallee stehen die Punkthochhäuser.
Hier haben die Archtitekten Luciano Baldessari (Hausnr.5), Johannes Hendrik van den Broek und Jacob Berend Bakema (Hausnr.7), Gustav Hassenpflug (Hausnr.9), Raymond Lopez und Eugène Beaudouin (Hausnr. 11-13), Hans Schwippert (Hausnr.16) ihre Bauten errichtet.

Jedes Haus sieht anders aus und ich finde, das macht das ganze Gebiet sehr abwechslungsreich. Diese Punkthochhäuser haben alle den Fahrstuhl mittig zu liegen, die Wohnungen mit ihren 1-3 Zimmern liegen darum herum.

Jeder der Architekten hat in seinen Haus kleine Besonderheiten eingeplant und verwirklicht. Sei es die leicht konkave Bauweise, eine Loggia, das großzügiges Foyer mit Aufzügen, Müllschlucker, Atelierwohnungen mit umlaufendem Balkon oder eine auffällige Fassadengestaltung.
Auch wenn der Zahn der Zeit sichtbar an den Gebäuden genagt hat, kann man sich gut vorstellen, wie begehrt diese Wohnungen einst waren. Hier wurden modernste Wohnanlagen mit hellen Wohnungen errichtet. Aufgrund der vorherrschenden Wohnungsgrößen von 1-2 Zimmern waren die meisten Wohnungen sicherlich nur für Einzelpersonen oder Paare geeignet.

Ebenfalls in der Bartningallee (Hausnr. 2-4) steht das Wohnhaus, dass von dem bekannten Architekten Egon Eiermann entworfen worden ist. Das 9-geschossige Scheibenhochhaus hat seine Treppen- und Fahrstuhltürme an den Giebelwänden. Im Erdgeschoss plante Eiermann Gewerbe- und Technikräume und in den darüber liegenden Etagen 96 Wohnungen (1-2 Zimmer). Dabei wechseln immer Stockwerke mit Flur und Einzimmerwohnungen und zur östlichen Seite liegenden Abstellräumen mit Geschossen ohne Flur und Zweizimmerwohnungen ab. Diese können nur durch die darunter liegende Etage über kurze Treppen erreicht werden.
Gewerbe befindet sich heute nicht mehr in der untersten Etage. Es erinnert nur noch das baulich stilistische Mittel der eingebauten Telegrafenmasten daran, dass hier die Post untergebracht werden sollte.

Hanseatenweg
Mein nächster Weg führte mich in den Hanseatenweg. Hier steht das Gebäude der Akademie der Künste.
Dieses Gebäude von Werner Düttmann wurde nicht im Rahmen der Interbau errichtet.

Der Gebäudekomplex besteht aus drei Teilen, die über verglaste Gänge und Hofflächen miteinander verbunden sind. Der Eingangsbereich ist etwas abgesenkt und liegt in einem verglasten Sockelgeschoss vor dem fensterlosen mit Waschbeton verkleideten Quader des Ausstellungsbereiches. Im Westen liegt ein schiefwinkliger Studiobau, der als Theater- und Veranstaltungssaal dient. Das Kupferdach reicht bis zum Erdboden und ich finde, es passt optisch so überhaupt nicht zum Ausstellungsgebäude. Aber das gilt auch für das Verwaltungs- und Atelierhaus im Osten des Grundstücks. Das „blaue Haus“ greift mit seinen Fenstern und der Fassade den modernen Bauhausstil auf.
Altonaer Straße
An der Altonaer Straße stehen zwei sehr auffällige Zeilenhochhäuser, die ich mir als nächstes genauer ansehe.


Oscar Niemeyer entwarf das Gebäude mit der Hausnummer 4-14. Er musste seinen ursprünglichen Entwurf umarbeiten, da er nicht den Anforderungen des sozialen Wohnungsbaus entsprach und viel zu kostspielig war. Sein überarbeiteter Plan hat seinen Vorstellungen nie so recht gepasst.
Das Haus steht auf sieben Doppelstützen. Guckt man durch sie hindurch, hat man nahezu freie Sicht ins Grüne. In dieser Art „Zwischenetage“ liegen auch die Hauseingänge. Der Fahrstuhl liegt in einem separaten Aufzugturm, der nur in der 5. und 8.Etage hält. Die 78 Wohnungen im Gebäude sind zwischen 38 und 91m2 groß, einige erstrecken sich quer durch das gesamte Gebäude.


Das zweite markante Gebäude an der Altonaer Straße 3-9 ist das sogenannte Schwedenhaus der Architekten Fritz Jaenecke und Sten Samuelson. Es bildet mit den Niemeyer-Haus den „Eingang“ zum Hansaviertel. Die Treppenhäuser befinden sich in Türmen, die über Laubengänge erreichtbar sind und vor dem Gebäude liegen. So sparten die Architekten den Platz im Gebäude und konnten mehr Wohnungen unterbringen.
Im Gebäude nutzten sie identische Wohnungsgrundrisse, die sie neben- und übereinander setzten. Ein für damalige Verhältnisse großer Luxus sind die eingebauten Fußbodenheizungen, die bis heute funktionieren. Das Erdgeschoss des Hauses wird noch heute für Geschäfte und ein Café genutzt.


Auf dem Weg zum Großen Stern bin ich noch am Eternit-Haus vorbei gekommen. Paul Baumgarten plante das als „Wohnschiff“ bezeichnete Haus. Über dem verglasten Erdgeschoss schwebt eine Gangway, Relings, Kajüten und Wohnkabinen – oder, wenn man es architektonisch betrachtet, verglaste Wohnstudios im modernen Design. Den Namen Eternit Haus erhielt das Gebäude, weil während der Interbau im Erdgeschoss der Hersteller Eternit einen Showroom nutzte. Die Fassade und das Dach sind entsprechend aus Eternit gestaltet.
Händelallee
Geht man an dem kleinen Platz vorbei, auf dem sich die Hansa Bibliothek befindet, gelangt am in ein Gebiet des Hansaviertels, dass mir vollkommen unbekannt war.

Hier stehen Einfamilienhäuser, die auch von mehreren Architekten entworfen worden sind.

Arne Jacobsen hat zum Beispiel die Häuser in der Händelallee 33-39 entworfen. Leider sieht man von der Straße aus nur einen Baukörper ohne Fenster und mit einer Eingangstür. De Häuser sind mit farbigen Platten verkleidet, es wirkt ein bißchen wie ein Haus aus einen Container. Was man von der Straße nicht sehen kann, die Häuser verfügen über ein Atrium, alle Zimmer sind um den begrünten Innenhof angeordnet.

Die Haus mit der Nummer 50 fällt auf, es ist optisch ganz anders als die anderen Häuser. Sergius Ruegenberg Wolf von Möllendorff hat das Haus geplant. Das Ziel des Architekten war es nicht nur die Wohnqualität zu verbessern, er wollte den Menschen mit seinem Tagesablauf in den Mittelpunkt seiner Planung stellen. Es entstand ein verwinkelter Grundriss, in dem der rechte Winkel ein Fremdwort ist.
Ebenfalls in der Händelallee steht das Haus, dessen Architekt mir am bekanntesten ist. Hier hat Walter Gropius ein Scheibenhochhaus errichtet. Das Haus ist eine Gemeinschaftsarbeit von Gropius mit der TAC und dem Architekten Ebert.

Das Gebäude wirkt optisch leicht gekrümmt, die Südfassade ist konkav geöffnet. Tatsächlich ist der Baukörper an vier Stellen geknickt, so dass sich dieser optische Effekt bildet. An der Ost- und Westecke sind Wohneinheiten um 90 Grad aus der Achse gedreht und ragen mit den Balkonen aus dem Baukörper heraus. Die Balkonbrüstungen wirken wie aufgeblähte Segel und lockern die Fassade optisch auf.

Klopstockstraße
Ich gehe weiter in die Klopstockstraße.


Hier steht noch ein großes Punkthochhaus, dass allgemein nur die Giraffe genannt wird. Es handelt sich um eins der ersten Häuser, das nur für Singles errichtet worden ist. Alle Wohnungen haben nur einen Wohnraum, ein kleines Bad und eine Kochgelegenheit. Pro Etage gibt es 10 Wohnungen mit schmalen Balkon und großen Fenstertüren. Was heute kaum noch nachzuvollziehen ist: im Westtrakt liegen die „männlichen“ Wohnungen mit einem Kochschrank, im Osttrakt gibt es „weibliche“ Wohnungen mit kleiner Küche.

Pierre Vago ist der Architekt des Hauses in der Klopstockstrasse 14-18. In seinen neungeschossigen Scheibenhochhaus gibt es Wohnungen mit 1-5 Zimmern, einige der Wohnungen erstrecken sich über 1,5 Etagen. Das kann man sehr gut bei einem Blick auf die Ostfassade erkennen, die Balkone sind in unterschiedlichen Höhen angebracht.

Nicht weit entfernt steht das Gebäude von Alvar Aalto. In seinem achtgeschossigen Zeilenbau gibt es 78 Wohnungen (1 – 4,5 Zimmer). Das besondere an diesem Bau, so finde ich, ist das offene erhöhte Erdgeschoss mit einem großzügige angelegten Eingangsbereich.
Kirchen
Nicht vergessen sollte man die beiden Kirchen, die nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg auch neu gestaltet wurden.


Beide Bauten sind von außen eher kirchenuntypisch und waren hochmodern konzipiert. Die Kirchentürme mit ihren freihängenden Glocken finde ich auch heute noch sehenswert.
Das Hansaviertel mit allen seinen baulichen Besonderheiten an nur einem Nachmittag zu erfassen, ist kaum möglich. Hier braucht es schon etwas mehr Zeit, um die Gebäude zu betrachten. Es gibt noch zahlreiche von mir unerwähnte Gebäude, die alle von interessante Architekten mit tollen Ideen geplant wurden.

















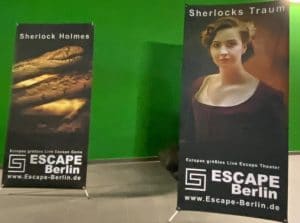
















































































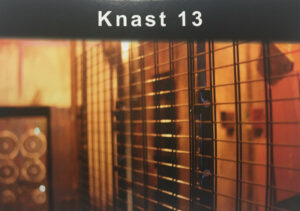












































Schreibe einen Kommentar