Läuft man die John-Foster-Dulles-Allee vom Berliner Reichstag in Richtung Schloss Bellevue kann man die Schwangere Auster und das Carillon eigentlich nicht übersehen – vorausgesetzt man weiß wonach man gucken muss.
Ich gebe zu, nicht jeder Berlinbesucher und auch nicht jeder Berliner kann mit dem Namen Schwangere Auster etwas anfangen. Aber wenn man das „Haus der Kulturen der Welt“ erwähnt, dann wissen die meisten Menschen eher wovon man spricht.

Von der Kongresshalle zum Haus der Kulturen der Welt
Als Kind habe ich noch von der Kongresshalle gesprochen und zugegeben der neue Name fällt mir oft nicht ein, wenn ich von der Schwangeren Auster spreche. Aber fangen wir von vorne an:
Entstehung der Kongresshalle
1957 fand die Internationale Bauausstellung Interbau in Berlin statt. Als Beitrag der USA entstand auf Initiative der damaligen Berlin-verantwortlichen im amerikanischen Außenministerium die Kongresshalle im Tiergarten. Für den Bau gründete man extra eine Stiftung (Benjamin-Franklin-Stiftung), die als Bauherr auftrat und die im April 1958 die Benjamin-Franklin-Halle als „Geschenk“ an die Stadt Berlin übergab. Wobei „Geschenk“ nicht ganz richtig ist. Es mussten zuvor unter anderem die Grundstückskosten übernommen werden.

Im gewissen Sinne war der neue Bau ein Propagandabau des Westens. Das Thema Bauen war zu einem Wettstreit der politischen Systeme geworden, die Bauaustellung Interbau sollte die Antwort auf die großzügige Stalinallee im Osten der Stadt sein. Die neue Kongresshalle stand in der Nähe, ja in Sichtweite zum sowjetischen Sektor. Man baute sie leicht erhöht auf einen Hügel, gab dem Dach eine leuchtend weiße Farbe und die Nachtbeleuchtung war Bestandteil des Baukonzepts. So war sie in dem Ostteil der Stadt sichtbar. Zusätzlich wählte man den Bauplatz auch an dieser Stelle aus, weil man erwartete, dass das zukünftige deutsche Regierungsviertel dort entstehen würde. Der Tiergarten war zu diesem Zeitpunkt abgeholzt und der Blick zum Reichstag frei.
Das Dach der Kongresshalle
Inspiration für das Dach holten sich die Architekten bei der Dorton Arena in North Carolina. Das frei hängende sattelförmige Dach wird dort von zwei Rundseilkabeln getragen. Die Zugkraft dieser sich kreuzenden Randseile wird an den Enden der Stahlbögen durch horizontale Spannseile im Erdboden miteinander verbunden. In Berlin baute man diese Konstruktion etwas anders, ja zog sogar zusätzlich ein zweites Dach in der Mitte ein. Diese Konstruktion, die man als Laie nicht wirklich versteht, stieß auf viel Kritik.

Und es schien etwas an der Kritik dran zu sein. Am 21.Mai 1980 stützte der südliche Teil des Daches mitten in einer Pressekonferenz ein. Es gab Verletzte und einen Toten. Spätere Analysen ergaben, dass der Einsturz eine Kombination mehrerer Ursachen war: mangelhafte Planung des Daches, mangelhafte Bauausführung, Statikfehler, Materialermüdung.
Für viele Berliner war das ein großer Schock – das Wahrzeichen der Stadt, die Schwangere Auster war zerstört. Es begann die Diskussion Abriß oder Wiederaufbau. Benötigt wurde die Tagungsräume nicht mehr. Inzwischen gab es mit dem ICC ein viel größeres Kongresszentrum. Man entschied sich, dass die Kongresshalle ein „geschichtliches und politisches Dokument“ sei und baute sie wieder auf. 1987 stand die Schwangere Auster dann wieder mit ihrem wunderschönen Dach im Tiergarten.
Wie kam es zum Namen „Schwangere Auster“?
Woher der Begriff genau kommt, ist nicht ganz geklärt. Einige schreiben ihn der Arbeit einiger Journalisten zu, andere sagen der Begriff wäre typisch Berliner Schnauze. Sicher ist, dass der Begriff Schwangere Auster sich auf die Muschelschalen-Form bezieht.
Eigentlich schade finde ich, dass sich die Spitznamen „Frau Dulles‘ Hut“ oder „Uncle Sams Zylinder“, die noch in der Bauphase entstanden, sich nicht halten konnten. Der überstehende Dachrand wurde eine zeitlang auch als Hutkrempe bezeichnet.

Nutzung des Gebäudes gestern und heute
Die Kongresshalle ist im Laufe der Jahre ein belieber Veranstaltungsort für Tagungen und Kongresse geworden.
1957 tagte der Deutsche Bundestag zum ersten Mal in Berlin, später folgten noch einige weitere Sitzungen. Diese Veranstaltungen fanden unter anderem in der Kongresshalle statt. Erst im Viermächte Abkommen 1971 regelte man, dass keine Plenarsitzungen mehr in Berlin stattfinden durften.
Seit 1989 ist die Kongresshalle der Sitz der neu gegründeten HKW. Damit änderte sich auch das Angebot innerhalb des Hauses. Neben dem deutsch-amerikanischen Schwerpunkt, gibt es nun zusätzlich ein multikulturelles Programm. Der neue Name der Kongresshalle spiegelt das hervorragend wider: „Haus der Kulturen der Welt“. Beaufsichtigt und gefördert wird das HKW vom Auswärtigen Amt.
In einigen Filmen taucht die Kongresshalle als Drehort auf. So kann man sie zum Beispiel im Science-Fiction-Film “Æon Flux” (2005) oder in der ZDF Reihe “Die Musterknaben” sehen.

Rundgang um das Gebäude
Kommt man von der John-Foster-Dulles-Allee steht man zunächst auf einem großen Vorplatz mit einem großen Wasserbecken, das von einem Betonsteg überspannt wird. In dem sogenannten Spiegelteich gibt es einen Springbrunnen und eine 1987 aufgestellte Bronzeplastik( Large Divided Oval: Butterfly) von Henry Moore.

Geht man über den Betonsteg gelangt man zu einer großen Treppe, die auf die Terrasse des Bauwerks führt. Früher war hier oben der Haupteingang, heute liegt er unterhalb der Treppe.
Auf der Terrasse kann man um das Gebäude herum gehen. Des ist schon beeindruckend das Dach aus dieser Perspektive zu sehen. Wo hier hat man zusätzlich einen wunderschönen Blick auf die Spree und kann bis in das Regierungsviertel gucken.

Geht man einmal um das Haus der Kulturen der Welt herum gelangt man direkt an das Spreeufer. Hier kann man in einem Café wunderschön sitzen und dem Schiffverkehr und den Spaziergängern zugucken.
Geht man zurück zur John-Foster-Dulles-Allee fällt sofort ein hoher Turm ins Auge, den man sich ruhig genauer angucken sollte.

Carillon
Ein Carillon ist ein von Hand gespieltes Glockenspiel, dass es bereits seit dem Mittelalter gibt. Die Carillonneure spielten vor und nach dem Gottesdienst und an Feiertagen. Das Glockenspiel besteht aus mindestens 23 gestimmten Glocken, einem Spieltisch mit Tastenstöcken und Pedalen. Die Glocken schwingen nicht. Den Ton erzeugt der Carillonneure indem er sie mit Klöppeln anschlägt, die mit den Tasten und Pedalen des Spieltisches verbunden sind.

1987 zum 750.Geburtstag von Berlin stiftete eine große weltbekannte Firma 2,8 Millionen Mark für die Anschaffung eines Carillons. Das Land gab noch einmal 2,2 Millionen Mark dazu. Mit der Errichtung des Turmglockenspiels wollte man den im Zweiten Weltkrieg zerstörten Glockenspielen in der Parchialkirche und der Potsdamer Garnisionskirche gedenken.
Das Carrillon im Tiergarten besteht aus vier Einzeltürmen, die zu einem Karree zusammen gestellt sind. Jeder Einzelturm ist 42 Meter hoch und mit schwarzem Granit verkleidet. Das Berliner Carillon hat 68 Kirchenglocken und ist das viertgrößte der Welt. Der Carrillonneure kann Stücke mit einem Tonumfang von fünfeinhalb Oktaven spielen.

Idealer Weise besucht man den Glockenturm um 12 oder 18 Uhr, wenn computergesteuert das Turmglockenspiel erklingt. Am Sonntag finden regelmäßig kleine handgespielte Konzerte statt. Von Anfang Mai bis Ende September um 15 Uhr, im Dezember um 14 Uhr wird hier live gespielt und im Anschluß kann man an einer kleinen Führung teilnehmen.
Anschrift:
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin

















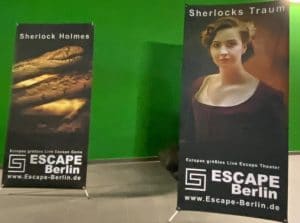
















































































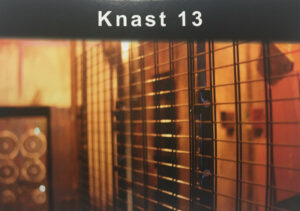












































Schreibe einen Kommentar